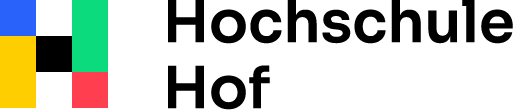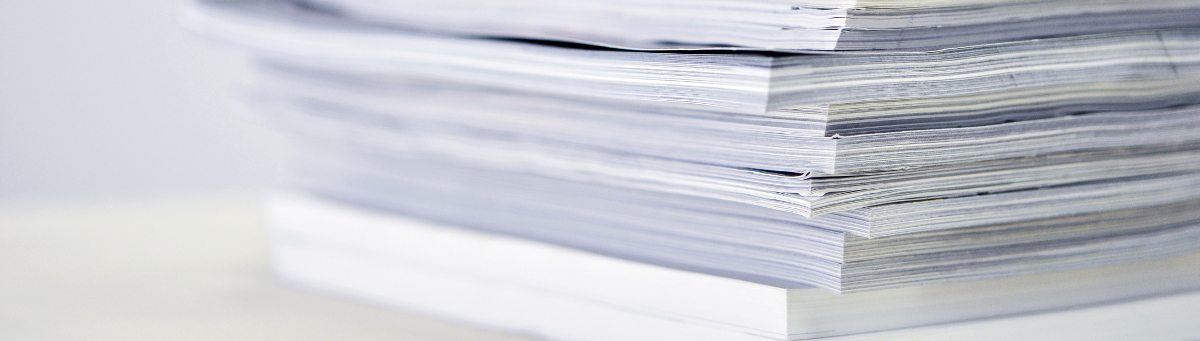
ePA für alle – Nutzung der ePA im Versorgungskontext
Wolff, Dietmar (2025)
Online-Veranstaltung zur ePa für alle, Der Paritätische Gesamtverband, online 12.03.2025.
Digital gestützter Medikationsprozess (dgMP) - welche Rolle spielt die Pflege?
Wolff, Dietmar (2025)
9. Fachtag Telematikinfrastruktur, Diakonie Baden-Württemberg, online 11.03.2025.
Kundenbindung 4.0: Wie Verlage mit KI ihre Abonnent:innen halten können.
Wagener, Andreas (2025)
dpr Magazin 2025 (04/25), 21-23.
Open Access
In der digitalen Marketinglandschaft entwickelt sich künstliche Intelligenz zum Game-Changer für Kundenbindungsstrategien. Wie Andreas Wagener in seinem Fachbeitrag "Wie KI das Loyalty Marketing verändert" aufzeigt, haben Unternehmen wie Starbucks, Sephora und Nike bereits innovative KI-gestützte Loyalty-Konzepte etabliert. Grundsätzlich werden 4 innovative Lösungsansätze durch KI identifiziert:
- Tiefere Personalisierung: KI-Systeme können Kundenpräferenzen präziser analysieren und maßgeschneiderte Angebote entwickeln
- Präzise Kundenvorhersagen: Frühzeitige Erkennung von Abwanderungsrisiken und automatisierte Rückgewinnungsmaßnahmen
- Effizientere Kommunikation: Optimale Ansprache zum richtigen Zeitpunkt über den bevorzugten Kanal
- Gamification: Spielerische Elemente erhöhen das Engagement und die emotionale Bindung
Für das KI-Briefing erläutert der Experte, welche spezifischen Potenziale sich daraus für Verlage ergeben.
Energy Efficiency Analysis in Industry 4.0 set up leveraging Industry 5.0 methods for Sustainable Manufacturing: Case Study
Cisneros Saldana, Shantall Marucia; Markus, Heike; Acharya, Sampat; Kapoor, Arshit (2025)
Procedia Computer Science 253, 594-602.
DOI: 10.1016/j.procs.2025.01.121.
Open Access Peer Reviewed
This study explores the integration of Industry 5.0 principles into existing Industry 4.0 configurations to address excessive heat dissipation, energy efficiency and promote carbon neutral manufacturing. Industry 5.0 represents a paradigm shift, emphasizing human-centered approaches, energy efficiency and environmental sustainability alongside traditional productivity goals. The case study analyzes energy consumption in an Industry 4.0 setup, quantifies heat waste and applies innovative solutions to optimize energy use. Considering digital manufacturing through the Industrial Internet of Things (IIoT), big data analytics, smart automation technologies in cyber-physical production systems and sustainable practices, the study aims to mitigate and minimize energy waste and carbon emissions. Through quantitative analysis, it identified energy inputs, mapped energy transformations, and assessed energy waste hotspots. Despite all the benefits of Industry 4.0, it showed that responsible practices and new initiatives are required to reuse and capitalize on that wasted energy or heat, underscoring the importance of integrating Industry 5.0 principles for sustainable manufacturing.
Plattformregulierung durch Dateneigentum: den Überwachungskapitalismus umkehren.
Wagener, Andreas (2025)
Nerdwärts.de https://nerdwaerts.de/2025/01/plattformregulierung-durch-dateneigentum-den-ueberwachungskapitalismus-umkehren/ 2025.
Open Access
Die großen digitalen Plattformen bestimmen nicht nur die Regeln auf ihren Märkten, sondern wirken zunehmend auch auf die gesellschaftliche Sphäre ein, mit oft als äußerst schädlich empfundenen Resultaten, wie etwa der Schaffung von Filterblasen und „Rabbit Holes“ oder der unkontrollierten Verbreitung von Fake News. Immer stärker werden daher die Rufe nach einer Beschränkung der Plattformmacht, nach Plattformregulierung oder sogar Zerschlagung der dahinterstehenden Konzerne laut. Dabei stellt sich die Frage, ob entsprechende Maßnahmen nicht an anderer Stelle ansetzen sollten – etwa beim „Treibstoff“ der Plattformökonomie, den Daten.
Geht man davon aus, dass die Macht der großen Tech-Plattformen ihren Ursprung vor allem in der Sammlung von Daten und deren algorithmischer Auswertung hat, so sollte sich womöglich auch die Plattformregulierung entsprechend hieran orientieren. Während der erste Teil dieses Artikels sich mit den Grundlagen der Plattformmacht im „Überwachungskapitalismus“ beschäftigte, widmet sich dieser zweite Teil nun möglichen Alternativen zu den gegenwärtigen Regulierungsbemühungen. Diese setzen nicht bei den gegenwärtigen Marktverhältnissen, sondern bei den individuellen Datenverfügungsrechten an.
Musterangebot
Wolff, Dietmar (2025)
Landesamt für Pflege Bayern TI-alog, online 13.02.2025.
Markenführung: KI im Marketing I: Technologie trifft Intuition – KI eröffnet für Marketing und Mediaplanung neue Möglichkeiten, aber es gibt einiges zu beachten
Wagener, Andreas (2025)
Markenartikel Magazin 2025 (1-2/2025), 44-45.
Es ist nahezu unmöglich, sich dem Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu entziehen. Insbesondere das Aufkommen der generativen KI, von Instrumenten wie ChatGPT oder Midjourney und der zugrundeliegenden großen Sprachmodelle, hat die Spielregeln für das Marketing neu definiert. Auch in der Mediaplanung, bei der Entwicklung und Umsetzung von Werbestrategien, entstehen neue Handlungsfelder, Chancen und Herausforderungen.
Flipper: Rowhammer on Steroids
Heckel, Martin; Adamsky, Florian (2025)
1st Microarchitecture Security Conference (uASC '25).
DOI: 10.46586/uasc.2025.002
Open Access Peer Reviewed
The density of memory cells in modern DRAM is so high that frequently accessing a memory row can flip bits in nearby rows. That effect is called Rowhammer, and an attacker can exploit this phenomenon to flip bits by rapidly accessing the contents of nearby memory rows. In recent years, researchers have developed sophisticated exploits based on this vulnerability, which enable privilege escalation on desktop computers, mobile devices, and even cloud systems without requiring any software vulnerability. However, rows are not equally vulnerable to Rowhammer. Therefore, an attacker has to massage the memory, for instance, with Page Table Entry (PTE) spraying, to increase the chance of successful exploitation. More bit flips mean the attacks become easier and faster to conduct.
In this paper, we present Flipper, a Rowhammer amplification attack against DDR3, consisting of two components: cmpIST exploits the cmpsb and repe x86 instructions to get DRAM access with higher frequency. cmpP AR exploits the effect of hammering in multiple threads, which increases the number of bit flips found in a given time, as shown in previous work. As a result, we can increase the number of bit flips by a factor of 830 on the measured devices, even on systems featuring mitigation techniques, without using administrative privileges. We evaluate our technique on six DDR3 DIMMs. Although DDR3 memory has been superseded by DDR4 and DDR5 memory technologies, it is still widely used in devices that do not require frequent replacement, such as projectors, smart displays, servers, embedded devices, routers, and printers.
Rechtliche Anforderungen an die Standardisierung und Digitalisierung der bauaufsichtlichen Prüfung der Standsicherheit
Lehmann, Marc (2025)
Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) 2025, 19-21.
Artificial Ground Truth Data Generation for Map Matching with Open Source Software
Wöltche, Adrian (2025)
Tagungsband FOSSGIS-Konferenz 2025 2025, 17.
DOI: 10.5281/zenodo.14774143
Open Access Peer Reviewed
Map matching is a widely used technology for assigning tracks recorded by Global Navigation Satellite Systems (GNSS) to existing road networks. Due to the measurement uncertainty of GNSS positions, the biggest challenge is to map them accurately. To develop and verify suitable algorithms for map matching, ground truth, i.e., the traveled routes in the road network, is required as a reference. However, GNSS recorded tracks naturally lack the ground truth routes. Providing this data is time-consuming and costly in these cases, as it requires manual correction of the routes based on human memorization. This is not practical on a large scale, e.g., with floating car data (FCD). This is why there exist only a few isolated ground truth data sets that were created in this way for map matching. To close this gap, we introduce and evaluate in this work a new open source tool-chain for artificially generating large amounts of simulated ground truth routes for map matching. Based on these routes, we generate simulated FCD and we apply comparably authentic and parameterizable artificial GNSS noise with varying noise characteristics. The generated data allows to thoroughly evaluate and improve the performance of existing map matching algorithms and facilitates in future research the development of novel algorithms based on sufficiently large and diverse labeled data. In this work, we evaluate different scenarios of varying noise characteristics of our artificially generated ground truth data to compare the robustness, individual strengths, and weaknesses of existing open source map matching implementations. Our new approach of artificially generating ground truth data for map matching addresses the existing lack of sufficient available reference data for ongoing map matching research.
Praxis-Unterstützung: Digitale Ausfüllhilfe für eHBA und SMC-B-Beantragung“,
Wolff, Dietmar; Stock, Nele (2025)
TI-Seminar, FINSOZ, online 29.01.2025.
Towards a size-aware implicit 2-D cloth rendering
Scharnagl, Bastian; Groth, Christian (2025)
2025 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and eXtended and Virtual Reality (AIxVR).
Peer Reviewed
There is a huge demand for trying on clothing at home. Recent methods to capture your figure mostly work in a 2d image plane and despite recent improvements of available technology the simulation of clothing is still not satisfactory. Especially the rendering of different clothing sizes is still a major challenge, which is only addressed by COTTON [1]. We propose an improvement to this approach by adding more control over the image generation process. For this we employ a special type of conditional diffusion model, namely ControlNet, and take keypoints of the fashion as conditional input. (This work is a part of the project (M4-SKI) has been supported and
funded by the European Regional Development Fund (ERDF)).
Im Fahrersitz sollte immer noch der Mensch sitzen.
Wagener, Andreas (2025)
CareTRIALOG, https://www.caretrialog.de/im-fahrersitz-sollte-immer-noch-der-mensch-sitzen.
Open Access
Wichtig ist, dass wir KI als Instrument zur Unterstützung begreifen. Der Einsatz von KI aus Marketingsicht und Möglichkeiten für den Bereich Pflege.
Afterimage duration differs for migraine with or without aura
Rimmele, Florian; Teuber, Julia; Müller, Britta; Giesen, Simeon; Drescher, Johannes; Scheidt, Jörg; Walter, Uwe; Kropp, Peter; Jürgens, Tim Patrick (2025)
Rimmele, Florian; Teuber, Julia; Müller, Britta; Giesen, Simeon; Drescher, Johannes...
Headache 65 (5), 756-763.
DOI: 10.1111/head.14934
Open Access Peer Reviewed
Background
It is controversial to what extent afterimages, as distinct visual phenomena, are altered in patients with migraine and whether they have a specific role in migraine pathophysiology.
Objective
The aim of this cross-sectional study was to investigate the duration of afterimages in patients with migraine, migraine with aura (MwA), and migraine without aura (MwoA), compared to healthy controls (HCs).
Methods
Adults with migraine, MwA, and MwoA, diagnosed according to The International Classification of Headache Disorders, third edition criteria and HCs without relevant headache history were included. Initially, factors affecting the experimental setting of testing afterimage latency were determined. Then, afterimage duration was measured in the two study groups (MwA and MwoA) and the HC group. Patient characteristics, intraocular pressure, and relevant comorbid conditions, as well as scales on depressive symptoms (nine-item Patient Health Questionnaire) and headache-specific psychosocial impairment (six-item Headache Impact Test) were recorded. Lastly, the role of different stimulus colors, as well as habituation effects after repeated stimulation, were investigated.
Results
The main study included 174 participants (40 with MwA, 53 with MwoA, and 81 HCs). The duration of the afterimage in patients with MwA was significantly longer than in HCs, at a mean (standard error of the mean [SEM]) of 12.6 (2.6) versus 5.5 ( 0.3) s (p = 0.035), while there was no significant difference between patients with MwoA (mean [SEM] 7.7 [1.6] s; p = 0.510) and HCs. There was also no significant effect of stimulus color on afterimage latency (mean [SEM] red: 8.9 [1.2] s and black: 8.4 [1.2] s).
Conclusion
We found significantly longer afterimage duration in patients with MwA compared to both HCs and patients with MwoA. Furthermore, partially selective stimulation of retinal rods and cones by different stimulus colors had no effect on afterimage duration suggesting a relevant subcortical and/or cortical modulation in migraine aura with increased excitability.
Ablehnung der Sturz App als DiPa ist überraschend, aber nicht unerwartet
Wolff, Dietmar (2025)
care konkret 3, 4.
KI im Weinbau: Anbau, Weinbereitung und Marketing.
Wagener, Andreas (2025)
Nerdwärts.de https://nerdwaerts.de/2025/01/ki-im-weinbau-anbau-weinbereitung-und-marketing/ 2025.
Open Access
Weinbau dürfte zu den ältesten und traditionsreichsten Branchen der Welt gehören. Politische Umbrüche und – natürlich vor allem in jüngerer Zeit – klimatische und ökologische Veränderungen sorgen, genauso wie technische Innovationen, für stetigen Anpassungsdruck bei der Erzeugung und Vermarktung von Wein. Auch die Digitalisierung der Weinwirtschaft schreitet immer weiter voran. Künstliche Intelligenz (KI) spielt im Weinbau eine zunehmend wichtige Rolle, über alle Glieder der Wertschöpfungskette hinweg.
Komprimierte KI - Wie Quantisierung große Sprachmodelle verkleinert
Peinl, René (2025)
c't - Magzin für Computertechnik 2025 (2), 120-125.
Große Sprachmodelle wie ChatGPT benötigen große und teure Server und viel Energie. Man kann sie aber quantisieren, sodass sie mit viel weniger Speicher und Strom auskommen und sogar lokal auf einem Smartphone laufen. Wir erklären, warum quantisierte Modelle viel schneller antworten und trotzdem fast so schlau sind wie die großen Originale.
Hypothetical constructs of consumer behavior as predictors of pro-environmental behavior. An empirical study based on smartphones.
Riedl, Joachim; Wengler, Stefan; Czaban, Marcin; Mohr, Sarah Victoria (2024)
Marketing Science & Inspirations 2024 (4), 25-44.
DOI: 10.46286/msi.2024.19.4.3
Open Access
Despite being a specific sustainable development goal (SDG), the role of consumers for sustainable consumption is still ambiguous. This is exemplified by a vast amount of research on the attitude-intention-behavior gap, which generally describes consumers’ failures to behave as sustainable as theoretically predicted. Recent reviews have prompted further investigations beyond the existing literature on factors influencing this gap. We contribute to this call by quantitatively investigating five antagonistic dimensions – both intrapsychic and situation-related – of smartphone usage and sustainable consumer behavior in Germany (n=800). Our results indicate two novel concepts. Emotional connection – i.e., consumers’ connections with the consumption experience – can either promote or prevent sustainable behavior, while exploration-driven consumerism – i.e., new purchases due to exploration tendencies – typically attenuates sustainable behavior. This illustrates how and when sustainability is outweighed by other consumer attitudes. We contextualize these results and conclude our study by highlighting limitations and further research opportunities.
AI and CX: A German perspective.
Wagener, Andreas (2024)
CRMKOnvos, https://www.youtube.com/watch?v=kEaQdpRL5DM .
Open Access
Seien Sie dabei, wenn wir am Dienstag, den 17. Dezember, einen aufschlussreichen Webcast zum Thema „CX und KI - eine deutsche Perspektive“ anbieten! 🌟
Entdecken Sie die einzigartige Sichtweise auf Customer Experience (CX) und Künstliche Intelligenz (KI) aus Deutschland. Unsere Experten werden sich mit folgenden Themen befassen:
Die deutsche CX-Perspektive und ihre Unterschiede zu Europa und den USA.
Der deutsche KI-Ansatz mit Fokus auf Branchen, Datenoptimierung und Qualitätsmanagement.
KI-Anwendungen aus der Praxis in Vertrieb, Marketing und dem öffentlichen Sektor.
Die Landschaft der KI-Startups in Deutschland und der DACH-Region.
Herausforderungen und Chancen der KI-Finanzierung, Regulierung und Nachhaltigkeit.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, wertvolle Einblicke zu gewinnen und sich mit Referenten und Experten der Branche auszutauschen!
Join us for an insightful webcast on "CX and AI - A German Perspective" on Tuesday, December 17th! 🌟
Explore the unique viewpoints on Customer Experience (CX) and Artificial Intelligence (AI) from Germany. Our experts will delve into:
The German CX perspective and its differences from Europe and the USA.
The German AI approach, focusing on sectors, data optimization, and quality management.
Real-world AI applications in sales, marketing, and the public sector.
The landscape of AI startups in Germany and the DACH region.
Challenges and opportunities in AI financing, regulation, and sustainability.
Don't miss this opportunity to gain valuable insights and engage with industry speakers and experts!
AI and CX: A German perspective.
Wagener, Andreas (2024)
CRMConvos, https://www.youtube.com/watch?v=kEaQdpRL5DM.
Open Access
Seien Sie dabei, wenn wir am Dienstag, den 17. Dezember, einen aufschlussreichen Webcast zum Thema „CX und KI - eine deutsche Perspektive“ anbieten! 🌟 Entdecken Sie die einzigartige Sichtweise auf Customer Experience (CX) und Künstliche Intelligenz (KI) aus Deutschland. Unsere Experten werden sich mit folgenden Themen befassen: Die deutsche CX-Perspektive und ihre Unterschiede zu Europa und den USA. Der deutsche KI-Ansatz mit Fokus auf Branchen, Datenoptimierung und Qualitätsmanagement. KI-Anwendungen aus der Praxis in Vertrieb, Marketing und dem öffentlichen Sektor. Die Landschaft der KI-Startups in Deutschland und der DACH-Region. Herausforderungen und Chancen der KI-Finanzierung, Regulierung und Nachhaltigkeit. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, wertvolle Einblicke zu gewinnen und sich mit Referenten und Experten der Branche auszutauschen! Join us for an insightful webcast on "CX and AI - A German Perspective" on Tuesday, December 17th! 🌟 Explore the unique viewpoints on Customer Experience (CX) and Artificial Intelligence (AI) from Germany. Our experts will delve into: The German CX perspective and its differences from Europe and the USA. The German AI approach, focusing on sectors, data optimization, and quality management. Real-world AI applications in sales, marketing, and the public sector. The landscape of AI startups in Germany and the DACH region. Challenges and opportunities in AI financing, regulation, and sustainability. Don't miss this opportunity to gain valuable insights and engage with industry speakers and experts!
Institut für Informationssysteme (iisys)
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
Alfons-Goppel-Platz 1
95028 Hof
T +49 9281 409 6112
sekretariat[at]iisys.de
Grit Götz
T +49 9281 409-6112
grit.goetz[at]hof-university.de